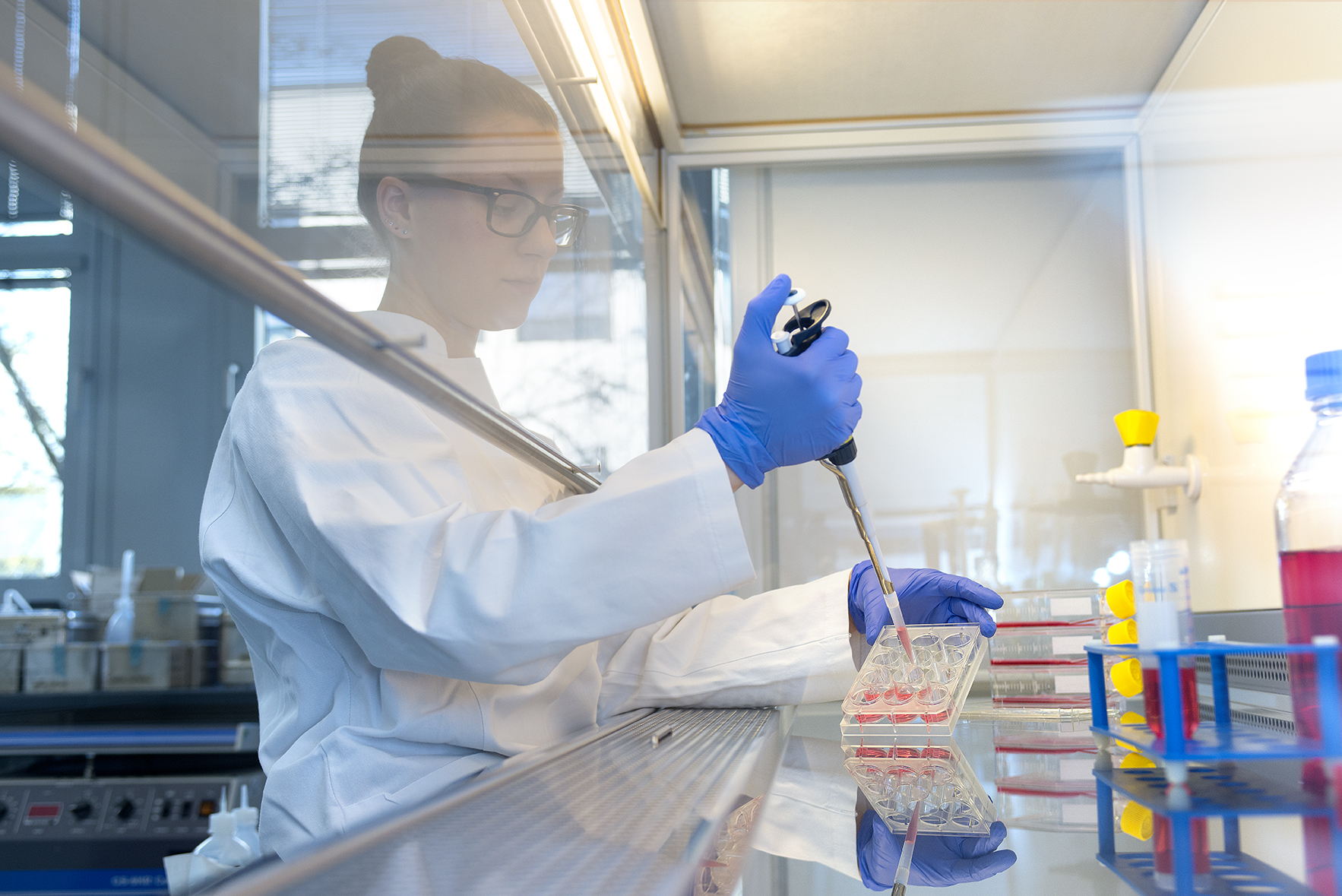
Innovative Therapeutika wie Biologika, die das Immunsystem modulieren, gewinnen zunehmend an Bedeutung. Ihre immunmodulierenden Eigenschaften können jedoch auch unerwünschte Wirkungen auf das Immunsystem hervorrufen. Aufgrund der hohen Spezifität und Komplexität dieser Therapeutika besteht die Gefahr, dass solche Nebenwirkungen in der nichtklinischen Entwicklung unentdeckt bleiben – insbesondere, wenn die verwendeten Testsysteme tierbasiert sind. Nebenwirkungen können sich erst in klinischen Studien zeigen und letztlich dazu führen, dass die klinischen Studien gestoppt und vielversprechende Arzneimittelkandidaten verworfen werden müssen.
Um potenzielle unerwünschte Effekte auf das menschliche Immunsystem frühzeitig zu identifizieren, sind neue Ansätze, Testverfahren und Technologien erforderlich. Das von der Innovative Medicines Initiative (IMI) der EU geförderte Forschungsprojekt »Immune Safety Avatar«, kurz imSAVAR, verfolgt das Ziel, ein systematisches und ganzheitliches Rahmenkonzept für die nichtklinische Sicherheitsbewertung von Biopharmazeutika und Arzneimitteln für neuartige Therapien (Advanced Therapy Medicinal Products, ATMP) zu entwickeln. Hierbei steht der molekulare Mechanismus, der zu unerwünschten Wirkungen führt, im Mittelpunkt.
Die Forschenden haben das Konzept des Adverse Outcome Pathway (AOP), das bereits erfolgreich bei der Risikobewertung von Chemikalien genutzt wird, im Projekt imSAVAR angewendet. Ein AOP beschreibt eine logische Abfolge kausal verknüpfter Schlüsselereignisse auf verschiedenen biologischen Ebenen (molekular, zellulär, auf Gewebe- und Organebene), die nach Exposition gegenüber einem Stressor zu einem unerwünschten Effekt führen. AOPs sollen vorhandenes Wissen über biologisch plausible und empirisch belegte Mechanismen zusammenfassen, um aus mechanistischen Daten toxikologische Vorhersagen abzuleiten. Sie bieten eine wissenschaftliche Grundlage zur Integration neuer Testmethoden, indem sie Erkenntnisse über biologische Mechanismen mit gezielten Testsystemen verknüpfen. Die Schlüsselereignisse eines AOPs müssen dabei essenziell für das Auftreten des Endpunkts sein und in einem klinischen Umfeld oder im Labor messbar gemacht werden können.
Forschende am Fraunhofer ITEM haben sich die Therapie mit Interleukin-2 (IL-2) und die dabei auftretenden Nebenwirkungen genauer angesehen. IL-2 wird zur Behandlung von Entzündungskrankheiten und Krebs eingesetzt, wobei häufig Hautausschläge als unerwünschte Wirkung auftreten. Die pathophysiologischen Mechanismen, die IL-2-induzierten Hautausschlägen zugrunde liegen, sind jedoch bislang unzureichend verstanden. Daher haben die Forschenden einen immunbezogenen AOP (irAOP) entwickelt, um mögliche Schlüsselzellen und -moleküle bei IL-2-induzierten Hautreaktionen zu identifizieren*. Mithilfe dieses Ansatzes wurde die Hypothese aufgestellt, dass die ausgelöste Immunreaktion überwiegend Typ-2-gesteuert ist und durch T-Helferzellen sowie durch angeborene lymphoide Zellen vermittelt wird, was zur Entstehung der Nebenwirkungen in der Haut während einer IL-2-Therapie führt.
Dieser irAOP bildet eine Grundlage, um zelluläre und molekulare Wechselwirkungen, die zu IL-2-induzierten Hautreaktionen führen, weiter aufzuklären. Er kann dazu genutzt werden, bestehende Testsysteme anzupassen oder neue zu entwickeln, um kutane Nebenwirkungen in zukünftigen IL-2-basierten oder ähnlichen Therapien besser vorherzusagen und zu verhindern.
 Fraunhofer-Institut für Toxikologie und Experimentelle Medizin
Fraunhofer-Institut für Toxikologie und Experimentelle Medizin